Törichte Lebewesen - Teil 3: Persönlich motivierte Ausweichmanöver
Im ersten Teil dieser Blockreihe haben wir einen Blick auf den Alltag und die trivialen Ausweichmanöver geworfen, die uns dort regelmäßig begegnen. Im zweiten Teil haben wir uns mit zwischenmenschlichen Beziehungen bzw. sozialen Konstrukten befasst und analysiert, wie sich diese auf unser Verhalten und unsere Beziehung zu unserem Selbst auswirken können. Nun gehen wir noch einen Schritt weiter. Ein wenig tiefer in die Selbstbetrachtung. Wir befassen uns mit persönlich motivierten Ausweichmanövern.
BLOGFEATURED ON HOMEPAGE
5/12/20245 min read
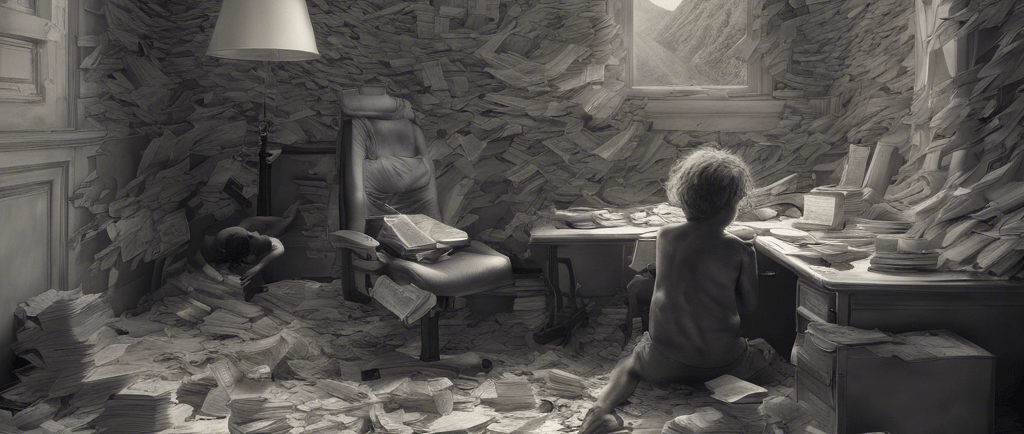
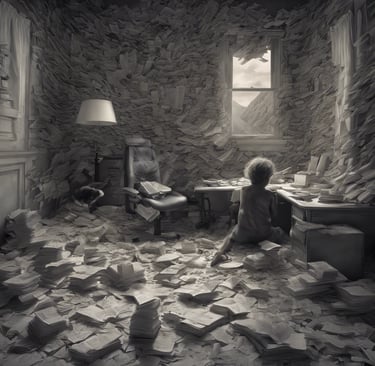
Im ersten Teil dieser Blockreihe haben wir einen Blick auf den Alltag und die trivialen Ausweichmanöver geworfen, die uns dort regelmäßig begegnen. Im zweiten Teil haben wir uns mit zwischenmenschlichen Beziehungen bzw. sozialen Konstrukten befasst und analysiert, wie sich diese auf unser Verhalten und unsere Beziehung zu unserem Selbst auswirken können. Nun gehen wir noch einen Schritt weiter. Ein wenig tiefer in die Selbstbetrachtung. Wir befassen uns mit persönlich motivierten Ausweichmanövern. Ausweichmanöver, die wir gezielt durchführen, um eine Konfrontation mit unserem Selbst zu vermeiden. Ausweichmanöver, die tief in unserer Identität verankert sind. So tief, dass wir sie als Teil unseres Wesens wahrnehmen. Wir wollen herausfinden, wie sie entstehen. Herausfinden, was sie mit uns machen. Herausfinden, wie wir sie erkennen und loswerden können.
Der Einfluss unserer Komfortzonen
Die Suche nach dem Ursprung dieser Ablenkungsmechanismen muss mit einem ehrlichen Eingeständnis beginnen: wir sind bequem geworden. Im Zuge der kontinuierlichen technologischen Weiterentwicklung der letzten Jahrzehnte haben wir es sehr gut verstanden, uns unseren Alltag so „gemütlich“ wie möglich zu gestalten. Wir haben unsere Haushalte zu Smart-Homes entwickelt, in denen wir fast alles per Knopfdruck von der Couch aus steuern können. Wir haben ein Lieblingscafé oder eine Lieblingsbar, gehen gerne die immer gleiche Runde spazieren – kurzum: wir bevorzugen es uns in einer vertrauten Umgebung aufzuhalten. Sie gibt uns Sicherheit, schützt uns vor unbekannten Gefahren. Inwiefern das nun schlecht sein soll? Erst einmal gar nicht. Im Gegenteil: nur in einem vertrauten Umfeld können wir ankommen, Wurzeln schlagen, Bindungen eingehen. In unseren Komfortzonen müssen wir uns nicht mit neuen Erfahrungen herumschlagen. Wir kennen uns aus und wissen genau, was passiert.
Dieser vermeintliche Vorteil wird bei einer unbewussten Lebensweise allerdings schnell zu einem einengenden Hemmnis. Denn bei genauerer Betrachtung ist nicht jede Komfortzone wirklich gemütlich. Im Gegenteil: wir sind Meister darin aus Bequemlichkeit in einem Zustand der Vertrautheit zu verharren. Selbst wenn uns dieser Zustand schadet. Wir sagen „Ja“ zu Dingen, um Konflikte oder Stress zu meiden. Akzeptieren das bekannte Übel und nehmen es hin, weil wir gelernt haben damit zu leben. Und wer weiß schon, ob im Unbekannten nicht noch viel schlimmere Übel lauern? Denn das Verlassen der Komfortzone ist ein Vordingen ins Ungewisse. Ein Vorstoß, der beängstigend erscheint, uns verunsichert. Gleichzeitig aber auch die einzige Option, wenn wir wirklich nach einer Verbesserung streben.
Das bekannte Übel ist nicht die bessere Wahl
Um konkret zu werden: ein Job, den wir „ganz okay“ finden, wird nicht plötzlich über Nacht aus Geisterhand besser. Wir können uns einreden, dass ein Abteilungswechsel alles ändert. Das eine Gehaltserhöhung die Situation neu darstellt. Aber dem ist nicht so. Egal welche Geschichte wir uns selbst erzählen. Das Gefühl in einem Lebensbereich „festzustecken“ ist in der Regel nichts anderes als ein Indikator dafür, einen genaueren Blick auf unsere Komfortzonen zu werfen. Sich selbst die Frage zu stellen „ist dem wirklich so?“. „Kann ich nichts tun, um etwas an der Situation zu ändern?“ In den seltensten Fällen wird die Antwort „Nein“ sein. Wir werden feststellen, dass die Geschichte, die wir uns einreden, nur der Ablenkung dient. Eine Ablenkung, um unsere eigene Passivität zu legitimieren.
Denn wenn wir nichts Grundlegendes in einem Lebensbereich ändern, in dem wir die Umklammerung der Komfortzone praktisch spüren können, bleibt Stagnation die logische Konsequenz. Nur mit einer aktiven Handlung, der Erforschung des Ungewissen, mit Mut zur Veränderung kann ebendiese Veränderung eintreten. Dieser Verantwortung müssen wir uns stellen. Vor allem, wenn wir uns selbst respektieren möchten und eine langfristig gute Bindung zu uns anstreben. Denn nichts ist trauriger als zu spät festzustellen, sich mit dem Mittelmaß zufriedengegen zu haben. Unsere Zeit ist begrenzt. Wir sollten nicht bereuen aus Bequemlichkeit Träume aufgegeben, oder Lebensumstände akzeptiert zu haben.
Was uns in der Komfortzone hält
Zeit für ein kurzes Zwischenfazit. Wir haben festgestellt, dass persönlich motivierte Ausweichmanöver Ihren Ursprung in unseren Komfortzonen finden. Sie sind der Konterpart zur Klarheit und äußern sich in Geschichten, die wir uns selbst einreden. Geschichten, die unser passives Verhalten rechtfertigen. Geschichten, die uns vorgaukeln, dass das Bekannte sicher und gut ist. Sie sind Gewohnheiten und Verhaltensmuster, die uns ein Gefühl von Kontrolle und Sicherheit geben. Sie sind Denk- und Handlungsspielräume, die wir selten verlassen, um uns vor Unbehagen zu schützen.
Nun, wenn wir all das wissen, warum fällt es und dann trotzdem so schwer aus unseren Komfortzonen auszubrechen. Wieso ist es eine so große Herausforderung, persönlich motivierte Ausweichmanöver abzulegen? Die Antwort ist einfach und liegt auf der Hand: wir haben Angst. Passivität trotzt persönlicher Unzufriedenheit in einer unserer Komfortzonen ist ein Symptom für Angst.
Wie Ängste unser Handeln bestimmen
Angst ist der stärkste limitierende Faktor bei der Auseinandersetzung mit dem Selbst und der persönlichen Weiterentwicklung. Sie bildet die Wurzel unserer Stagnation. Unsere Unfähigkeit sich mit unseren Ängsten auseinanderzusetzen ist hauptverantwortlich dafür, dass wir in unseren Komfortzonen verharren. Mit unseren persönlich motivierten Ausweichmanövern schützen wir uns vor einer Konfrontation mit unseren Ängsten. Wir vermeiden es aktiv, uns der Wahrheit anzunähern. Mit Blick auf unsere Ängste lassen sich diese in vier Grundformen unterscheiden: Bindungsangst, Verlustangst, Angst vor Veränderung und Angst vor Selbstverwirklichung. Nicht selten treten einige dieser Ängste bei uns parallel auf, wirken also -wenn man so möchte- „doppelt lähmend“.
Als Beispiel führe ich hier gerne den bereits zuvor thematisierten Jobwechsel an. Neben der offensichtlich aufkommenden Angst vor Veränderung kann dabei auch, vor allem wenn dieser Jobwechsel mit der Verwirklichung eines Lebenstraums einhergeht, die Angst vor Selbstverwirklichung auftreten. Wir scheuen also nicht nur das neue, unbekannte Umfeld und die dort noch nicht bekannten Herausforderungen. Wir fürchten auch, dass wir erfolgreich sein könnten. Klingt paradox, ist bei genauerer Betrachtung aber alles andere als das. Schließlich haben wir durch unsere persönlich motivierten Ausweichmanöver meist über einen langen Zeitraum an unserer Komfortzone festgehalten und unsere Geschichte des „Feststeckens“ reich verziert. Wenn wir nun den Schritt ins Unbekannte gehen und dabei auch noch Erfolg haben, decken wir unsere eigene Heuchelei auf. Wir erkennen, dass wir eine selbst kreierte Geschichte zu einem Teil unserer Identität gemacht haben. Eine Teilidentität, die wir aufgeben müssen. Gewissermaßen muss ein Teil unseres alten Selbst sterben. Und das ist natürlich beängstigend.
Auf der anderen Seite ist das Reflektieren unserer Ängste und die aktive Konfrontation damit essenziell, wenn wir unser Leben verbessern, persönlich motivierte Ausweichmanöver erkennen und beenden möchten. Dabei verfolgen wir nicht das Ziel frei von Ängsten zu sein. Denn sind wir ehrlich: das wird nicht möglich sein. Es geht vielmehr um den richtigen Umgang mit unseren Ängsten. Ein Umgang, der uns lehrt Ängste zu erkennen und auszuhalten. Ein Umgang, der uns beibringt, dass Ängste natürlicher Bestandteil unseres Lebens sind, aber ebendieses Leben nicht bestimmen dürfen.
Was mitzunehmen ist
Wohin uns das führt? Ich würde sagen, einen Schritt weiter. Wir haben reflektiert, dass der Ursprung jeglicher Stagnation in einer Angst, oder mehreren Ängsten verborgen liegt. Diese Ängste hemmen uns, sorgen dafür, dass wir in einigen Lebensbereichen in unseren Komfortzonen verharren. Dort verharren, obwohl wir uns nicht wohlfühlen. Um dieses Verweilen zu legitimieren, bauen wir uns leicht verdauliche Geschichten auf, mit denen wir uns identifizieren. Die unsere Untätigkeit rechtfertigen, obwohl wir unterbewusst wissen, dass wir uns selbst täuschen. Eine kostspielige Selbsttäuschung, die über viele Jahre skaliert zu Zorn gegenüber uns selbst führen kann. Und genau diesen gilt es zu verhindern. Verhindern, indem wir Bewusstheit über unsere Ängste schaffen und deren Ursprünge erforschen.
